KMU sind das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft und sie tragen einen überproportional grossen Teil der Regulierungskosten. Diese belaufen sich gemäss Hochrechnungen des sgv auf rund 10% des Bruttoinlandprodukts, das sind rund 70 bis 80 Milliarden Franken pro Jahr. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet dies eine enorme Zusatzbelastung, die ihre Wettbewerbsfähigkeit einschränkt.
Daher muss die Politik zwingend datenbasiert abschätzen können, wie hoch die Regulierungskosten ausfallen. Behauptungen führen immer wieder zu Fehleinschätzungen mit unabsehbaren Folgen. 2023 hat das Parlament das Unternehmensentlastungsgesetz (UEG) verabschiedet, das auf Initiative des Schweizerischen Gewerbeverbandes aufgegleist wurde Im Herbst 2024 ist das UEG in Kraft getreten. Jetzt braucht es aber dringend weitere Massnahmen zur Entlastung von Unternehmen und zudem eine unabhängige Prüfstelle. Eine solche wurde 2023 im Rahmen der Beratungen zum UEG abgelehnt.
Schluss mit faktenfreier Behauptung
Wie wichtig sie ist, zeigt jetzt das jüngste Beispiel aus dem Bereich Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Das zuständige Bundesamt hatte eine Agentur beauftragt, im Schlussbericht über die Regulierungskosten zu informieren. Behauptet wurde in der Folge unter Ausblendung vieler wichtiger Faktoren – und damit falsch - ein angeblicher Nutzen von neuen Werbebeschränkungen. Eine Schätzung der Regulierungskosten fehlte gänzlich. An diesem Beispiel zeigt sich ein grundlegendes Problem, sagt sgv-Direktor Urs Furrer. «Auftragnehmer haben ein Interesse am Erhalt von weiteren Aufträgen. Darum neigen sie zu Ergebnissen im Sinne der auftraggebenden Ämter.»
Zur Beseitigung dieses Missstandes fordert der sgv, dass Regulierungskostenschätzungen künftig von einer verwaltungsunabhängigen Stelle überprüft werden. «Denn KMU sollen sich nicht länger auf Informationen verlassen müssen, deren Erhebung ein regulierungswilliges Bundesamt selber in Auftrag gegeben hat», sagt sgv-Präsident und Ständerat Fabio Regazzi.
Der Vorschlag des sgv: Eine KMU-Regulierungskostenbremse greift automatisch, sobald eine bestimmte Anzahl Schweizer KMU betroffen ist oder die erwarteten Mehrkosten für KMU über einer bestimmten Kostenschwelle liegen. Die Verantwortung für die zuverlässige Prüfung liegt bei der entsprechenden Kontrollstelle. Die KMU-Regulierungsbremse greift, indem der betreffende Regulierungsvorschlag im Gesetzgebungsprozess erhöhte Anforderungen bezüglich Mehrheitsquoren oder kompensatorische Massnahmen erfüllen muss.



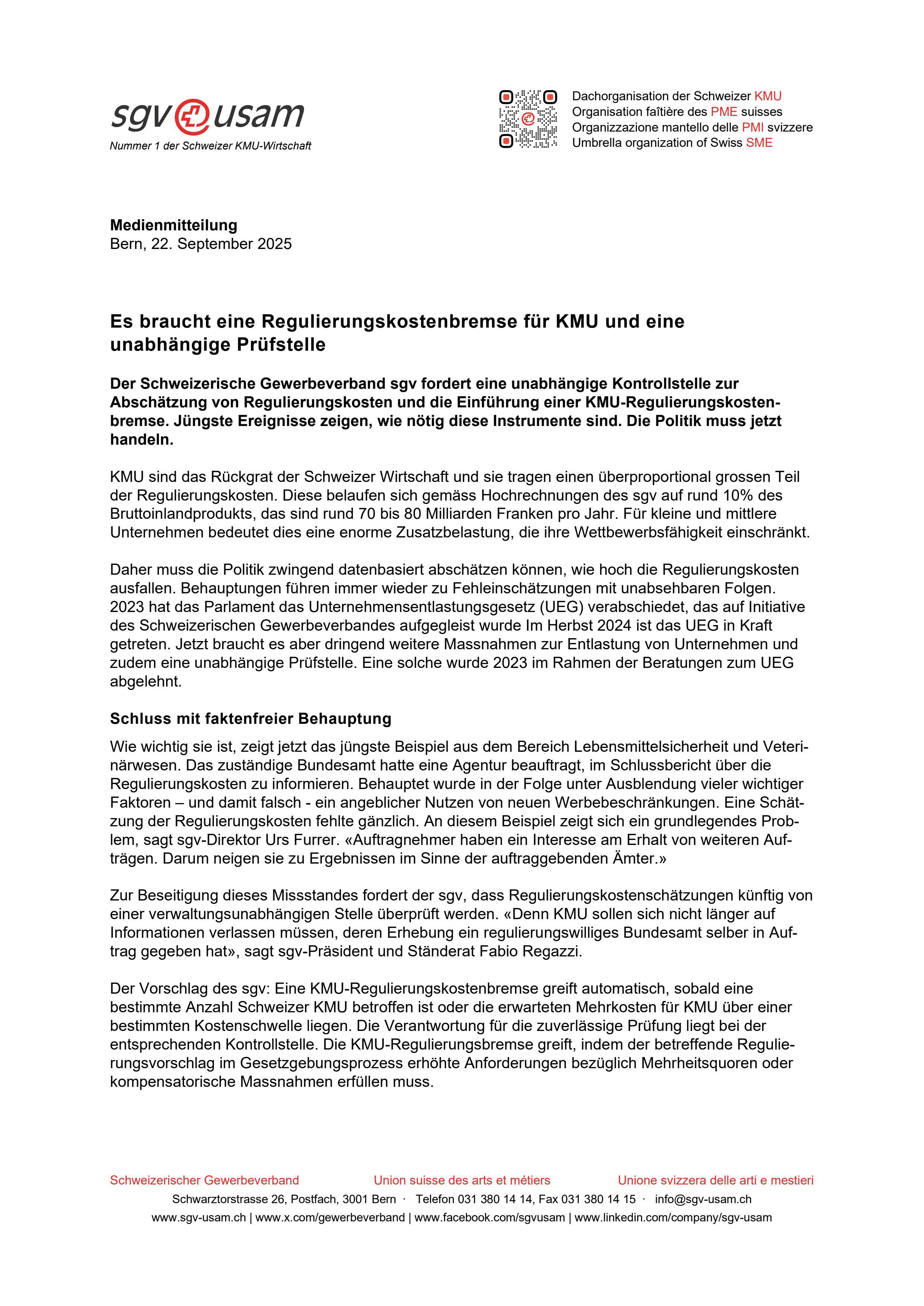
Es braucht eine Regulierungskostenbremse für KMU und eine unabhängige Prüfstelle